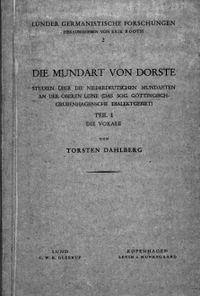Die Mundart von Dorste
von Wolfgang Leopold
Während der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die ostfälischen Mundarten Gegenstand sehr lebhaften Interesses von Seiten der Wissenschaft. Imponierend ist Schambachs mächtiges Wörterbuch über die Mundart der alten Fürstentümer Göttingen und Grubenhagen (1858). In diesem Jahrhundert entstanden viele Arbeiten, die sich mit den plattdeutschen Mundarten beschäftigten und einen Eindruck über die vielfältigen dialektischen Unterschiede lieferten. In vielen Gegenden, auch unseres weitläufigen Sprachgebietes, entstanden eine ganze Reihe Wörterbücher, teils qualifiziert, teils oberflächlich. Überliefert ist, dass das westfälische Gebiet sprachwissenschaftlich deutlich besser behandelt wurde; das ostfälische eher stiefmütterlich.
Ein Gebiet, das Mitte des 19. Jahrhunderts, gewissermaßen noch einen weißen Fleck auf der Dialektkarte bildete, war das sogenannte göttingisch-grubenhagensche, dass in mehrerlei Hinsichten den Übergang des ostfälischen zum westfälischen (und mitteldeutschen) bildete.
Wenn wir über den Lautstand des göttingisch-grubenhagenschen Bescheid haben wollen, sind wir immer noch auf das jetzt 76 Jahre alte schambachsche Wörterbuch angewiesen, stellte Torsten Dahlberg (schwedischer Dialektforscher) Mitte der 1930er Jahre bei seinen sprach-wissenschaftlichen Arbeiten als Göttinger Student fest. Diese Arbeit mit Ihren etwa 10.000 Stichwörtern ist eine sehr anerkennenswerte Leistung. Besonders wertvoll ist das Wortmaterial, weil es zu einer Zeit gesammelt wurde, als das Plattdeutsche viel besser beibehalten war als heutzutage (1934). Ein Negativum aus heutiger Sicht war allerdings, dass Schambach sich hauptsächlich für die Wörter interessierte. Um die Laute, um die wechselnde Aussprache in den verschiedenen Ortschaften, kümmerte er sich dagegen weniger. Lautvarianten wurden darin nur sparsam angegeben.
Torsten Dahlberg hat in seinen Arbeiten in der ersten Hälfte der 1930er Jahre versucht, Klarheit in die lautlichen Verhältnisse des gött.-grubenhag. Sprachraumes zu bringen, was ihm auch sehr gut gelungen ist. Der Hauptzweck seiner Arbeiten sollte eine Beschreibung der Mundart von Dorste und eine dialektgeographische Untersuchung einiger wichtiger Erscheinungen innerhalb eines grösseren Gebietes sein. Was versteht man nun unter dem Begriff „das göttingisch-grubenhagensche Dialektgebiet? Im Brockhaus Konversationslexikon von 1908 definierte Bremer es als ein Gebiet, das sich von Münden und Duderstadt bis Holzminden, Bodenwerder, Gandersheim, Grund und Osterode erstreckt. Der „ostfälische“ Sprachraum, dessen Sprachraum wir uns in Dorste heute zugehörig fühlen, wird im großen Brockhaus Bd. 4 (1929) noch sehr vorsichtig angegeben. Dort erfahren wir, dass das „ostfälische“ von Hildesheim und Goslar in der West/Ostachse bis an die Tore Magdeburgs reiche. Südlich der Linie Hildesheim – Goslar sprach man also damals noch vom göttingisch-grubenhagenschen Sprachraum.
Kehren wir zu Dorste zurück. 1934 schreibt Torsten Dahlberg in seinem Buch „Die Mundart von Dorste“, das der Ort ca. 1400 Einwohner zählt, protestantisch ist und die Bevölkerung größtenteils mit der Landwirtschaft beschäftigt ist. Die Umgangssprache ist noch immer meist plattdeutsch, jedoch sprechen auch die Ältesten sämtlich hochdeutsch. Laut Dahlberg erinnerte man sich in Dorste sehr lebhaft des alten Nachbardorfes „Thomashagen“. „ Thomashagen“ lag zwischen Dorste und Wulften. Zeitgeschichtlich sollen sich die Einwanderer aus Thomashagen an einer besonderen Strasse, nämlich der Hagenstrasse niedergelassen haben. Nach Aussage von vielen Dorstern wich ihre Aussprache früher von der von Dorste etwas ab.
Der Ortschronist Karl Könemund schrieb: Als um das Jahr 1930 ein schwedischer Professor von der Universität Lund (Schweden) Sprachstudien in der Göttinger Gegend betrieb, kam er auf einer Wanderung auch durch Dorste. Nachdem er einen Einwohner in der Burgstelle ergebnislos angesprochen hatte, traf er auf die alte Frau Linsenhoff, die gegenüber der Pfarrei wohnte. Hier fand er, was er suchte, nämlich deren volkstümliche, reichlich mit dem Laut „a“ durchwebte Aussprache. Das entzückte ihn so sehr, dass er einen seiner Schüler (Torsten Dahlberg) bewog, seine deutschen Sprachstudien in Dorste zu betreiben. So kam der Student Torsten Dahlberg nach Dorste.
Erst heute können wir richtig ermessen, welchen unsagbaren Schatz Torsten Dahlberg Dorste mit seinen sprachwissenschaftlichen Ausarbeitungen hinterlassen hat. Er ist damals in einem größeren geografischen Raum wissenschaftlich (er besuchte nicht weniger als 140 Ortschaften in dem in Rede stehenden Sprachraum) unterwegs gewesen, sein Schwerpunkt war aber immer Dorste. Seine Doktorarbeit schrieb er dann dankeswerterweise über die „Dorster Mundart“.
Quelle: Die Mundart von Dorste von Torsten Dahlberg, Herausgeber Erik Rooth, 1934
Karl Könemund (Ortschronist) schrieb am 04. November 1961 im Osteroder Kreisanzeiger unter der Rubrik „Unter dem Harze“ über die Arbeit Torsten Dahlbergs u. a. folgendes:
Warum wurde gerade Dorste zum Standort der Dialektforschung gewählt, da es nicht einmal der Mittelpunkt des Gebiets war. Das geht hervor aus der Eintragung eines alten Lehrers in die Schulchronik. Dort schreibt er: Die Aussprache der Dorster leidet an dem Übelstand, dass sie den Laut „a“ gewaltig vortönen lässt. Man spricht hier Claas (Claus), Waalke (Wöhlke), Ulenspaagel (Eulenspiegel), kaapen (kaufen), Kah (Kuh) oder, wie es durch freundliche Hilfe der Nachbardörfer sprichwörtlich geworden ist: Häst’t Flaatchen haart up’n Chaaseplane? (Hast du das Flöten/Pfeifen gehört auf dem Gänseplane?) Oder: „Et is ne Kunst, out twa Aaren drei Aarkauken to backen, aber et gaht!“ (Es ist eine Kunst, aus zwei Eiern drei Eierkuchen zu backen, aber es geht.) Diese Aussprache ist auch deshalb ein Übelstand, weil sie beim Erlernen des Hochdeutschen und im Gesangsunterricht störend wirkt. Und dieser Übelstand wurde die Veranlassung zur Bearbeitung der Dorster Mundart. „Die Lundner Germanistischen Forschungen“ wurden herausgegeben von Professor Erik Rooth, dem Lehrer und Betreuer Torsten Dahlbergs.
Anm. Wolfgang Leopold: Prof. Erik Rooth hatte sich längere Zeit zum Studium des Göttingisch-Grubenhagenschen in der Göttinger Gegend aufgehalten und bat daraufhin seinen Schüler, den stud. phil. Torsten Dahlberg aufgrund bestimmter Erfahrungen, die er in Dorste machte, sich dieser plattdeutschen Mundart anzunehmen.
So hielt sich der Student Torsten Dahlberg in den Jahren 1931 – 1934 in Dorste und Echte auf, um seine Doktorarbeit vorzubereiten und abzuschließen. Wie anhänglich T. Dahlberg auch heute (1961) noch an Dorste ist, geht aus einem Brief hervor, den er am 21. September 1961 an seinen kranken Freund Fritz Wedemeyer, Hs.-Nr. 217 schrieb. Wer die vier Teile der göttingisch-grubenhagenschen Studien lesen will, muss die Phonetik der Germanisten beherrschen. Torsten Dahlberg bemerkt, dass Dorste eine Übergangs-Mundart zwischen zwei Sprachgebieten bildet, die er hier einbeckisch und göttingisch-niedereichsfeldisch nennt. Der hochdeutsche Einfluss ist in Dorste zwar geringer als in den meisten umliegenden Dörfern, aber immerhin bedeutend. In vielen Fällen ist das plattdeutsche Wort von dem entsprechenden hochdeutschen verdrängt worden. Zahlreiche alte Dialektwörter sind in Vergessenheit geraten. Es gilt hier zunächst, die noch lebenden Dialektwörter dem Vergessenwerden zu entreißen, ehe es zu spät ist.